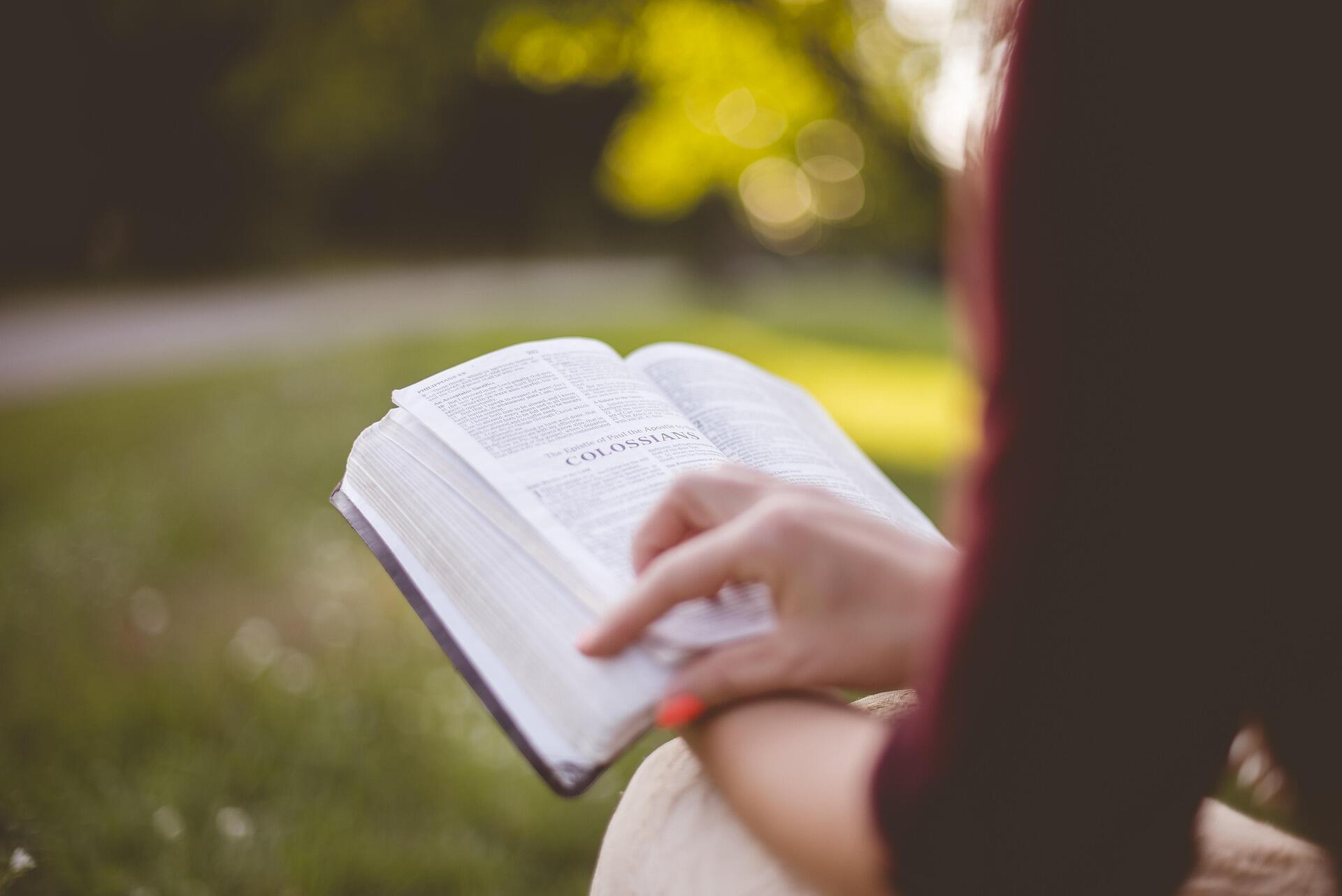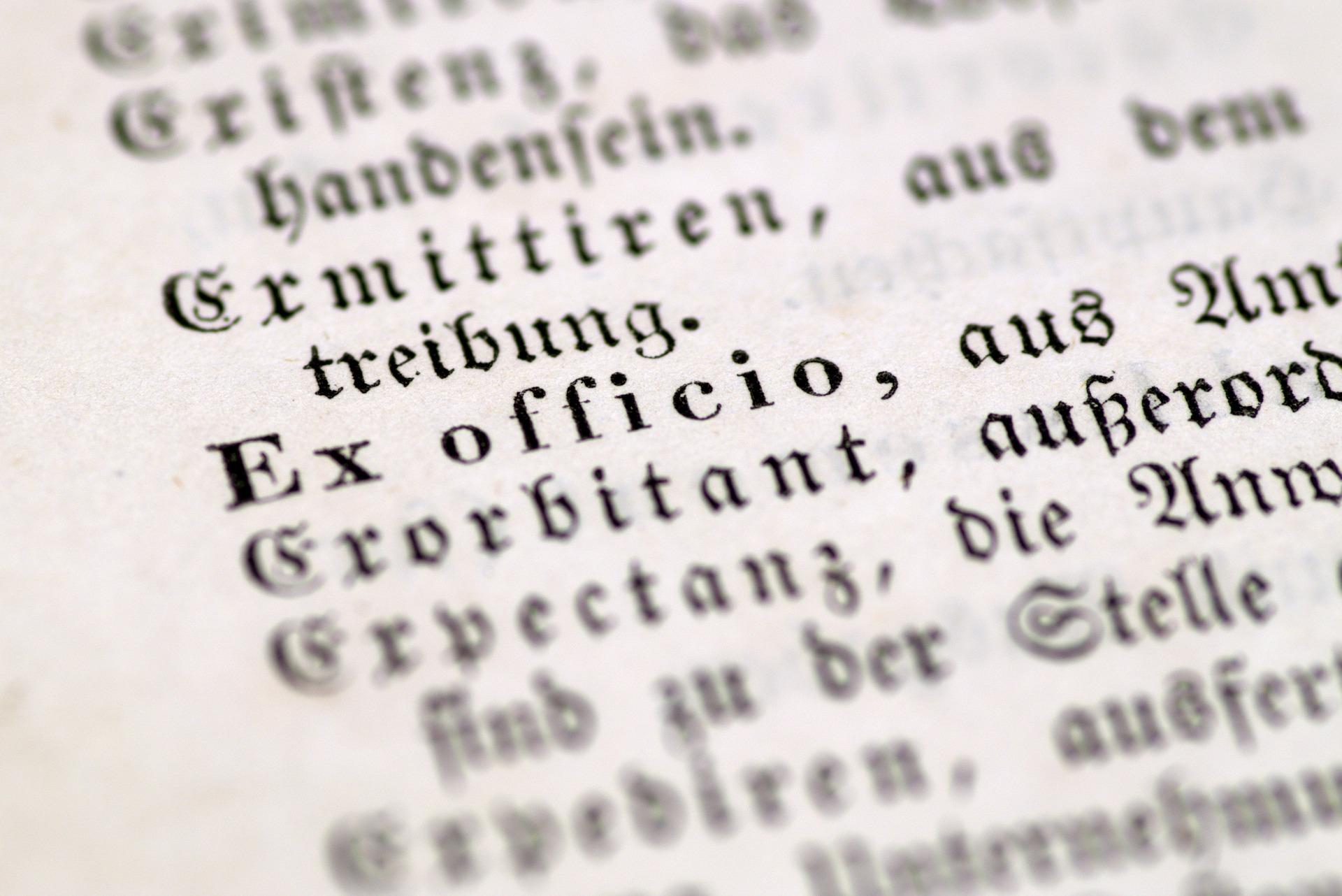Eine satzwertige Konstruktion ist eine grammatikalische Struktur, die eine vollständige Aussage im Satz ersetzt, jedoch keine eigene Konjunktion benötigt. Sie kann als eigenständiger Satz fungieren und wird in der Regel durch andere Satzteile wie ein Infinitiv, Partizip oder eine Kombination dieser gebildet.
In diesem Artikel nehmen wir vier wichtige Satzkonstruktionen des Lateinischen unter die Lupe: das Partizipialkonstrukt (PC), der Accusativus cum Infinito (AcI), der Nominativus cum Infinitive (NcI) und der Ablativus Absolutus (Abl. Abs.). Jede dieser Konstruktionen hat ihre eigene Funktion und ist entscheidend für das Verständnis und die Übersetzung von lateinischen Texten.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Der AcI ersetzt im Deutschen einen Nebensatz, der die Handlung von Verben wie "sehen" oder "glauben" näher beschreibt.
- Der NcI wird durch passive Kopfverben im Lateinischen ausgelöst und übersetzt sich häufig mit einem "dass-Satz" im Deutschen.
- Der Abl. Abs. besteht aus einem Substantiv im Ablativ und einem dazu passenden Partizip und drückt eine vom Hauptsatz unabhängige Zusatzinformation aus.
- Das PC beschreibt einen Nomen im Hauptsatz näher und steht in direkter Verbindung mit ihm, ohne ein eigenes Subjekt zu benötigen.

Participium Coniunctum einfach erklärt
Das Participium Coniunctum (PC) ist eine typische lateinische Partizipialkonstruktion, die dir in vielen Texten begegnet. Es besteht aus einem Partizip und einem Nomen, die im Kasus, Numerus und Genus übereinstimmen. Das heißt: Beide Wörter passen grammatisch genau zueinander und bilden eine feste Einheit im Satz.
Obwohl das PC wie ein Teil des Satzes wirkt, steckt oft ein ganzer Nebensatz dahinter. Es hat satzwertigen Charakter. Das Nomen des PCs ist gleichzeitig Teil des Hauptsatzes und des PC selbst. Die Zeitform des Partizips zeigt dabei das Zeitverhältnis an:
- Das PPA (Präsens) steht für Gleichzeitigkeit
- Das PPP (Perfekt) steht für Vorzeitigkeit
- Das PFA (Futur) steht für Nachzeitigkeit
PC bilden und erkennen: So funktioniert's
Das PC wird aus einem Nomen und einem Partizip gebildet. Sie stimmen im Kasus, Numerus und Genus überein, sind also KNG-kongruent. Verwendet werden können, wie bereits erwähnt, das PPA, PPP oder PFA. Beide Bestandteile stehen meist direkt beieinander, manchmal aber auch durch weitere Wörter getrennt.
Erkennen kannst du diese Konstruktion, wenn ein Partizip (z.B. auf -ns, -tus, -turus) mit einem Substantiv im gleichen Kasus, Numerus und Genus übereinstimmt. Das ist das Bezugswort. Alles zwischen Partizip und Substantiv gehört zur PC-Konstruktion. Ein PC ist nicht durch Satzzeichen abgetrennt und wirkt wir ein normaler Satzteil. Kontext und Struktur helfen dir, es zu erkennen.
Funktion des Participium Coniunctum
Das PC ist eine typische lateinische Satzkonstruktion aus dem Partizip und Bezugswort im gleichen Kasus, Numerus und Genus. Es beschreibt ein Substantiv näher und ersetzt im Deutschen oft einen Nebensatz. Meist hat es eine attributive Funktion, kann aber auch adverbial gebraucht werden oder eine zugewiesene Eigenschaft ausdrücken:
Attributive Funktion:
Hier ist das PC eine nähere Beschreibung eines Substantivs, also einer Person oder Sache.
Adverbialer Gebrauch:
Damit werden Zeit, Grund oder Art und Weise ausgedrückt. Zum Beispiel: "weil", "nachdem" oder "indem".
Zugewiesene Eigenschaft:
PC drückt eine zugewiesene Eigenschaft aus, etwa "als einen, der...".
Dabei gilt stets: Die genaue Bedeutung ergibt sich immer aus dem Kontext!
AcI in Latein erkennen und übersetzen
Der Accusativum cum Infinitivo, kurz AcI, ist eine weitere typische Konstruktion im Lateinischen. Sie tritt besonders nach Verben des Sagens, Denkens oder Wahrnehmens auf. Statt eines Nebensatzes verwendet das Latein den AcI, um knapp und ohne Konjunktion auszudrücken, was jemand sagt, glaubt oder wahrnimmt.
Der AcI besteht aus einem Akkusativ als logischem Subjekt und einem Infinitiv als Prädikat. Im Deutschen entspricht er meist einem "dass"-Satz. Beispiel: Scio Corneliam venire heißt: "Ich weiß, dass Cornelia kommt." Wörtlich lässt sich der AcI oft nicht übersetzen, daher ist ein gutes Sprachgefühl entscheidend.
So erkennst du den AcI
Einen AcI erkennst du daran, dass er aus drei Teilen besteht: einem Akkusativ als logischem Subjekt, einem Infinitiv als Prädikat und einem übergeordneten konjugierten Verb, meist ein sogenanntes Kopfverb. Diese Kopfverben drücken Sagen, Denken, Wahrnehmen oder Fühlen aus. Zum Beispiel:
- dicere = sagen
- videre = sehen
- scire = wissen
- gaudere = sich freuen
Findest du ein solches Verb, solltest du nach einem AcI Ausschau halten, zum Beispiel: "Gustav gaudet Corneliam venire" → "Gustav freut sich, dass Cornelia kommt."
Übersetzung eines AcI
Der AcI ist eine satzwertige Konstruktion. Das bedeutet: Obwohl im Lateinischen nur ein Satz steht, brauchst du im Deutschen oft einen Nebensatz, um den Sinn korrekt zu erfassen. Die beste und sicherste Übersetzung ist meist ein dass-Satz.
Zum Beispiel: "Marcus videt Corneliam ad forum currere" → "Markus sieht, dass Cornelia zum Forum läuft". Dabei wird der Akkusativ zu einem Nominativ und der Infinitiv zu einem finiten verb. Eine wortgenaue Übersetzung geht nur manchmal. Unser Tipps: Beginne mit dem dass-Satz, um klar und verständlich zu bleiben.
Zeitverhältnisse im Blick
Der AcI im Lateinischen wird je nach Tempus des Infinitivs unterschiedlich übersetzt. Dabei gibt es drei Hauptzeitverhältnisse:
Gleichzeitig (Infinitiv Präsens):
Die Handlung des AcI erfolgt gleichzeitig mit der des Hauptsatzes.
Vorzeitig (Infinitiv Perfekt):
Die Handlung des AcI geschieht vor der Hauptsatzhandlung.
Nachzeitig (Infinitiv Futur):
Die Handlung des AcI erfolgt nach der Hauptsatzhandlung.
Achte auf das Tempus des Infinitivs, um die Zeitverhältnisse korrekt zu übersetzen.
Das solltest du über den NcI wissen
Der Nominativus cum Infinitivo, kurz NcI, ist eine besondere Konstruktion, die keine direkte Entsprechung im Deutschen hat. Er besteht aus einem Nominativ (Substantiv oder Pronomen), einem Infinitiv und einem passiven Kopfverb wi dicitur oder videtur.
Im Gegensatz zum AcI bleibt das Subjekt des Infinitivsatzes auch formell das Subjekt des gesamten Satzes. Der NcI wird im Deutschen meist mit einem dass-Satz übersetzt. Diese Konstruktion ist besonders wichtig für die Analyse und Übersetzung lateinischer Texte.
NcI übersetzen leicht gemacht
Ein NcI besteht aus einem Nominativ, einem Infinitiv und einem passiven Kopfverb. Um ihn zu erkennen, achte darauf, dass das Subjekt im Nominativ steht und nicht im Akkusativ, wie es beim AcI der Fall ist. Oft handelt es sich um die passive Form eines Verbs, das im Aktiv einen AcI auslöst.
Merkmale eines NcI:
- Passives Verb
- Nominativ als Subjekt
- Infinitiv als Prädikat
Typische Verben, die einen NcI auslösen, stammen meist aus den Bereichen Sagen, Meinen oder Wahrnehmen. Dazu gehören passive Formen wie "dicor" (man sagt), "putor" (man glaubt), "videor" (man verbietet mir) und "cogor" (ich werde gezwungen). Diese Verben stehen im Passiv und werden mit einem Infinitiv kombiniert. Das Subjekt des NcI steht im Nominativ und ist gleichzeitig das Subjekt des Kopfverbs. So erkennst du schnell, ob ein NcI vorliegt.
So übersetzt du den Nominativus cum Infinitivo
Die Übersetzung des NcI erfolgt in klaren Schritten: Zuerst übersetzt du das Passiv-Verb im Hauptsatz unpersönlich, um Beispiel mit "man sagt" oder "es wird gesagt". Anschließend fügst du einen dass-Satz an, in dem der Nominativ zum Subjekt und der Infinitiv zum Prädikat wird.
Beispiel: "Rex in villa vivere dicitur" → "Es wird gesagt, dass der König in der Villa lebt." Bei Verben wie videtur oder dicitur kann auch eine deutsche NcI-Form genutzt werden, etwa "Die Dörfer sollen geplündert worden sein". Wichtig ist, auf die Kongruenz zwischen Subjekt und Verb zu achten.
NcI: So bestimmst du das richtige Tempus
Beim NcI richtet sich das Zeitverhältnis nach dem Tempus des Infinitivs. Ein Infinitiv im Präsens zeigt eine gleichzeitige Handlung zur Hauptsatzhandlung. Ein Perfekt-Infinitiv bedeutet Vorzeitigkeit – die NcI-Handlung geschah also zuvor. Der Futur-Infinitiv zeigt Nachzeitigkeit, also eine zukünftige Handlung. Diese Regeln gelten auch bei einem Hauptsatz im Präteritum – das Verhältnis bleibt gleich.
Hier ein paar Beispiele:
- Quintus pensum facere dicitur. → "Man sagt, dass Quintus die Aufgabe macht."
- ...fecisse dicitur. → "...dass er sie gemacht hat."
- ...facturus esse dicitur. → "...dass er sie machen wird."
Ablativus Absolutus im Lateinischen: Was ist das?
Der Ablativus Absolutus ist eine typische lateinische Partizipialkonstruktion, die grammatikalisch vom Hauptsatz unabhängig steht, ihn aber inhaltlich ergänzt. Er besteht immer aus einem Substantiv im Ablativ und einem dazu kongruenten Partizip im Ablativ – also gleicher Kasus, Numerus und Genus.
Meist steht das Partizip Präsens Aktiv (PPA) oder Partizip Perfekt Passiv (PPP) – das PFA wird nicht verwendet. Der Abl. Abs. im Lateinischen ersetzt im Deutschen oft einen Nebensatz: z.B. kausal, temporal oder konditional. Er ist also losgelöst, aber nie bedeutungslos.
Der Abl. Abs. lässt sich leicht erkennen, wenn du systematisch vorgehst:
- Finde das Partizip (PPA oder PPP).
- Suche ein Substantiv im Ablativ, das zum Partizip passt (KNG).
- Markiere beide Wörter und prüfe, ob alles dazwischen dazugehört.
- Achte darauf, dass die Konstruktion unabhängig vom Hauptsatz ist und keinen Partizipialattribut darstellt.
Der Abl. Abs. drückt oft Zeit, Grund, Bedingung oder Begleitumstände aus.
Der Ablativus Absolutus: Übersetzungsmöglichkeiten
Der Abl. Abs. wird im Deutschen immer als eigenständiger Nebensatz übersetzt, obwohl er im Lateinischen grammatikalisch unabhängig ist. Es gibt drei gängige Möglichkeiten, ihn zu übersetzen:
- Nebenordnung: Der Abl. Abs. wird als Nebensatz mit einer passenden Konjunktion übersetzt (meist temporal, kausal, modal, konzessiv oder konditional). Beispiel: "Fabulis narrantibus mnes lacrimabant" → "Während die Geschichten erzählt wurden, weinten alle."
- Beiordnung: Der Abl. Abs. wird als Hauptsatz übersetzt, oft verbunden durch "und". Beispiel: "Hostibus accendentibus cives excitati sunt" → "Die Feinde näherten sich, und die Bürger wurden geweckt."
- Substantivierung: Der Abl. Abs. wird als Präpositionalausdruck übersetzt, indem das Partizip substantiviert wird. Beispiel: "Hostibus moventibus Accursius territus est" → "Wegen der Bewegung der Feinde ist Accursius erschrocken."
Jede dieser Übersetzungen hilft dabei, die Bedeutung des Ablativus Absolutus korrekt wiederzugeben.
Unterschied zwischen Ablativus Absolutus und Partizipialkonstruktion
Abl. Abs. und PC ähneln sich im Aufbau: Beide bestehen aus einem Partizip und einem KNG-kongruenten Substantiv. Doch es gibt auch wichtige Unterschiede: Beim Abl. Abs. stehen beide Teile immer im Ablativ und bilden eine vom Hauptsatz unabhängige Nebensatzbedeutung. Er enthält nie das PFA.
Das PC hingegen beschreibt ein Nomen im Hauptsatz näher und ist direkt in den Satz eingebunden. So erkennst du, ob es sich um einen losgelösten oder eingebundenen Zusatz handelt. Der Abl. Abs. steht also eigenständig neben dem Hauptsatz, während das PC als Attribut eng mit einem Nomen im Hauptsatz verbunden ist.
Mit KI zusammenfassen: