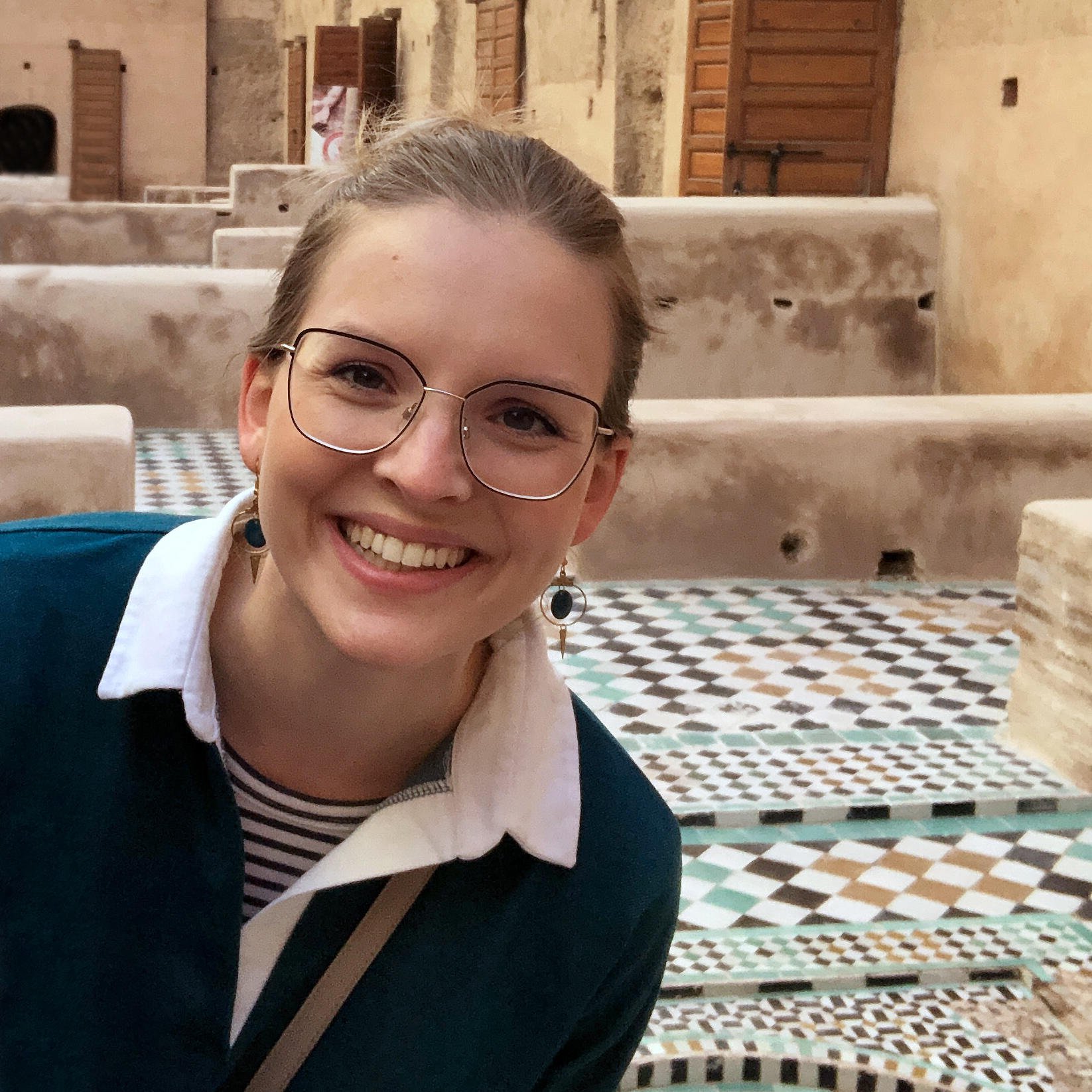Wie sähe die Welt heute ohne Elektromagneten aus? Dafür müssen wir erstmal verstehen, was ein Elektromagnet ist. Elektromagnete sind spezielle Magnete, die nur dann magnetisch sind, wenn elektrischer Strom durch sie fließt. Sie bestehen in der Regel aus einer Drahtspule, durch die Strom geleitet wird, und oft einem Eisenkern im Inneren. Dadurch entstehen besonders starke, aber abschaltbare Magnetfelder.
Elektromagnetismus beschreibt die Wechselwirkung zwischen elektrischen Strömen und magnetischen Feldern. Fließt Strom durch einen Leiter, entsteht ein Magnetfeld – und umgekehrt kann ein veränderliches Magnetfeld Strom erzeugen. Dieses Prinzip ist die Grundlage für Motoren, Generatoren, Transformatoren und vieles mehr.
Ob in Elektromotoren, Computern, Zügen oder Transformatoren – Elektromagneten sind aus dem modernen Alltag nicht mehr wegzudenken. Ohne sie würden viele Technologien gar nicht funktionieren.

Wann wurde der Elektromagnet entdeckt?
Die Geschichte des Elektromagnetismus beginnt Anfang des 19. Jahrhunderts – und mit ihr ein neues Zeitalter in Technik und Physik.
Zu dieser Zeit wurde die Technologie auch erfunden, als zwei Wissenschaftler, Hans Christian Ørsted in Dänemark und William Sturgeon in England, unabhängig voneinander Elektrizität und Magnetismus miteinander interagieren ließen. Ørsted fand als erstes heraus, dass ein elektrischer Strom ein Magnetfeld erzeugt. Das war revolutionär – denn erstmals wurde eine direkte Verbindung zwischen Elektrizität und Magnetismus sichtbar.
Wenig später, 1825, entwickelte der Brite William Sturgeon den ersten funktionsfähigen Elektromagneten, indem er einen Draht um einen Eisenkern wickelte und Strom hindurch leitete. So konnte er ein viel stärkeres, steuerbares Magnetfeld erzeugen.
1820
Ørsted
Ørsted entdeckt den Zusammenhang zwischen Strom und Magnetfeld
1825
Sturgeon
Sturgeon baut den ersten Elektromagneten
1827
Ampère
Ampère beschreibt die Kräfte zwischen stromdurchflossenen Leitern
1831
Faraday
Faraday entdeckt die elektromagnetische Induktion
1906
Weiss
Weiss entwickelt die Theorie der Magnetdomänen
Für fast ein weiteres Jahrhundert wusste aber noch keiner genau, wie diese Kupfer Drahtspule ein Magnetfeld schaffen konnte, bis im Jahre 1906 der französischer Physiker Pierre-Ernest Weiss das Problem anging. Mit seiner Theorie der Magnetdomänen konnte er das Rätsel, was im Mitte dieser Drahtspulen überhaupt vorgeht, etwas aufdröseln.
Diese Variante überspringt allerdings zwei der wichtigsten Namen in der Geschichte des Elektromagnetismus. Vielleicht habt Ihr schon von Michael Faraday gehört, dem Entdecker der elektromagnetischen Induktion. Oder vom Namensgeber der Einheit Ampere, André-Marie Ampère, welcher entdeckte, dass zwei parallele Drähte sich gegenseitig an- und abstoßen, abhängig davon, in welche Richtung der Strom fließt.
Elektromagnetismus ist seit jeher eine Technologie, die unsere Welt Tag für Tag am laufen hält, ohne, dass wir ihr je genug Tribut zollen könnten.
Was ist Magnetismus überhaupt?
Bevor wir verstehen, wie Elektromagneten funktionieren, lohnt sich ein kurzer Blick auf das physikalische Phänomen dahinter: Magnetismus. Die Details hierzu findet Ihr in unserem Artikel Was ist Magnetismus? Aber eine kleine Wiederholung kann nie schaden.
Magnetism, as you recall from physics class, is a powerful force that causes certain items to be attracted to refrigerators.
Dave Barry
Magnetismus entsteht auf subatomarer Ebene – genauer gesagt durch die Bewegung und den Spin von Elektronen. Elektronen sind negativ geladene Teilchen, die sich in einem Atom um den Atomkern bewegen. Viele Elektronen treten in Paaren mit entgegengesetzten Spins auf, wodurch sich ihre magnetischen Wirkungen gegenseitig aufheben.
In bestimmten Materialien – sogenannten ferromagnetischen Stoffen wie Eisen, Kobalt oder Nickel – gibt es jedoch viele ungepaarte Elektronen. Wenn sich diese Spins in eine gemeinsame Richtung ausrichten, entsteht ein messbares Magnetfeld.
Diese Ausrichtung passiert in kleinen Bereichen, den sogenannten magnetischen Domänen. Wird ein äußeres Magnetfeld angelegt, können sich diese Domänen angleichen – das Material wird magnetisch.

Anders als natürliche Magneten erzeugen Elektromagneten ihr Magnetfeld nicht durch den Aufbau des Materials selbst, sondern durch den Fluss von elektrischem Strom. Wie das genau funktioniert, erklären wir dir im nächsten Kapitel!

Was ist Elektromagnetismus?
Während wir gerade den natürlichen Mechanismus von Magneten beschrieben haben, funktionieren Elektromagneten etwas anders. Die Entdeckungen von Ørsted, Ampère und Faraday waren bahnbrechend – sie zeigten, dass Magnetismus auch durch elektrischen Stromfluss entstehen kann.
Wenn Strom durch einen Draht fließt, bildet sich um ihn herum ein Magnetfeld. Je stärker der Strom, desto stärker das Feld. Diese Wirkung liegt am Verhalten der Elektronen, die sich in leitenden Materialien – wie Kupfer – frei bewegen. Ihre Bewegung erzeugt eine gerichtete magnetische Wirkung: den Elektromagnetismus.
Kurz erklärt: Ein Elektromagnet ist also ein Magnet, dessen Feld nur dann wirkt, wenn Strom fließt – im Gegensatz zu einem Dauermagneten.
Elektromagnetismus als Grundkraft der Physik
Elektromagnetismus ist weit mehr als ein Effekt in einer Drahtspule. Er zählt zu den vier fundamentalen Kräften der Natur – neben der Gravitation, der starken Kernkraft und der schwachen Wechselwirkung. Diese grundlegenden Kräfte bestimmen die physikalischen Gesetze unseres Universums.
Elektromagnetische Wechselwirkungen sind verantwortlich dafür, dass sich elektrisch geladene Teilchen gegenseitig anziehen oder abstoßen. Ohne diese Kraft gäbe es keine Atome, keine Moleküle – und somit keine Materie, wie wir sie kennen.
Der Elektromagnetismus ermöglicht es Licht, sich im Raum auszubreiten, hält Elektronen in der Umlaufbahn um Atomkerne und sorgt dafür, dass chemische Bindungen entstehen können. Damit bildet er die Grundlage für nahezu alle Vorgänge in der Chemie, Physik und Biologie.
Seine Entdeckung und die Fähigkeit, ihn gezielt zu nutzen, markieren einen Meilenstein in der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung – von der Elektrizität bis zur modernen Kommunikation.
Findet hier mehr über Magnetismus und Elektromagnetismus heraus!
Elektromagnetische Wellen
Elektromagnetismus zeigt sich nicht nur in Magnetfeldern – auch Licht ist eine elektromagnetische Welle! Tatsächlich umfasst das elektromagnetische Spektrum eine breite Palette von Wellenlängen: von Radiowellen über Mikrowellen, Infrarot, sichtbares Licht, UV-Strahlung bis hin zu Röntgenstrahlung und Gammastrahlen.
All diese Wellenarten haben eines gemeinsam: Sie entstehen durch das Zusammenspiel von elektrischen und magnetischen Feldern, die sich gegenseitig antreiben und gemeinsam durch den Raum schwingen.
Diese Wellen machen vieles in unserem Alltag erst möglich: WLAN, Mobilfunk, MRT-Geräte, Satellitenkommunikation oder einfach das Sonnenlicht, das die Erde erwärmt. Ohne elektromagnetische Wellen gäbe es keine moderne Technik – und keinen sichtbaren Himmel!
Wie funktioniert ein Elektromagnet?
Aber wie funktioniert ein Elektromagnet denn genau? Wir haben seine Hintergründe jetzt genug angeschaut, also woraus besteht ein Elektromagnet?
Ein elektrischer Magnet funktioniert ungefähr so wie ein einfacher Stabmagnet. Genau wie ein normaler Dauermagnet hat auch er einen Nordpol und einen Südpol, welche identische Pole anderer Magneten abstoßen. Genau wie etwa Eisenspäne produziert auch er ein Magnetfeld.
Der Unterschied zwischen einem Elektromagneten und einem normalen Magneten ist jedoch, dass der Elektromagnet ein viel stärkeres Magnetfeld hat. Außerdem kann er natürlich an- und ausgeschaltet werden, indem der Strom gekappt wird. Diese beiden Eigenschaften machen den elektrischen Magnet zu einer sehr hilfreichen Entdeckung.
Woraus besteht ein Elektromagnet?
Wie oben bereits angedeutet ist die physikalische Ursache für die magnetische Kraft bei Ferromagneten eine andere als bei ihren elektromagnetischen Cousins. In ersteren sind die Elektronen ausgerichtet, während in letzterem der Elektronenstrom, also Elektrizität, das Magnetfeld kreiert.
Wie Ampère bereits zeigte, sind Drähte an sich magnetisch. Um aber einen Elektromagneten zu bauen, nutzen wir eine etwas bessere Methode.
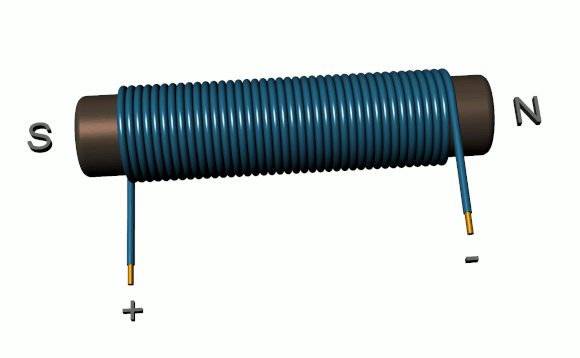
Dafür brauchen wir Drahtspulen. Man nehme ein zylindrisches Stück Ferromagnet, etwa Eisen, und wickle eine Drahtspule aus Kupfer drum herum. Sobald man nun die Elektrizität anschaltet, läuft der Strom durch die Spule und magnetisiert das Metall im Zentrum, genau wie ein Dauermagnet.
Sobald die Elektrizität aus ist, schwindet auch die magnetische Kraft des Metalls.
Das ganze ist eigentlich recht einfach. Man braucht auch nicht unbedingt einen eisernen Kern, denn das von der Spule produzierte Magnetfeld ist bereits auf das Loch in der Mitte der Spule zentriert. Ein eiserner oder “magnetischer” Kern macht den Elektromagneten allerdings noch stärker, ums Tausendfache sogar.
Ihr könntet sogar selbst einen Elektromagneten herstellen, wenn Ihr wolltet. Aber passt auf, eine erfahrene Person an der Seite ist sicher hilfreich.
Wofür benutzen wir Elektromagneten?
Kehren wir also zur Frage zurück: Wie sähe die Welt heute ohne Elektromagneten aus? Eine wirklich interessante Frage, die man aber vielleicht besser so stellen könnte: Welche Dinge gäbe es heute ohne Elektromagneten nicht?

Die Antwort darauf könnte sehr lang ausfallen. Sie lässt sich aber auch mit einem kurzen Blick auf die wichtigsten und allgegenwärtigsten Technologien beantworten, welche Elektromagnetismus nutzen. Und mit allgegenwärtig meinen wir auch allgegenwärtig.
Elektrische Motoren und Generatoren
Ein elektrischer Motor wie in Autos oder anderen Maschinen nutzt die Interaktion eines Magnetfelds mit einem elektrischen Strom.
Sie bestehen aus einem Stator, einem statischen Magneten am Rande des Motors, sowie einem Rotor, einem rotierenden Elektromagneten, der der gerade beschriebenen Drahtspule gleicht.
Sobald Elektrizität in die Spule fließt, wird diese vom Stator angezogen, welcher dann umgedreht wird und die Spule wieder abstößt. Dadurch dreht sich die Spule kontinuierlich und produziert mechanische Energie.
Diese Motoren lassen sich übrigens überall finden, von Euren Computern und Kopfhörern bis hin zum Ofen und der Festplatte.
Generatoren sind dem auf mechanischer Ebene identisch, sie arbeiten jedoch umgekehrt.
Hier findest du noch weitere Beispiele für Elektromagnetismus im Alltag:
| Alltagsanwendung | Erklärung |
|---|---|
| Elektromotoren | Nutzen das Magnetfeld, um mechanische Bewegung zu erzeugen. |
| Lautsprecher & Kopfhörer | Erzeugen Töne durch magnetisch bewegte Membranen. |
| Transformatoren | Verändern die Spannung von Strom durch magnetische Induktion. |
| Türklingeln | Erzeugen über einen Elektromagneten ein akustisches Signal. |
| MRT (Magnetresonanztomographie) | Erzeugen starke Magnetfelder zur Darstellung von Gewebe. |
| Induktionsherd | Erzeugen Hitze durch magnetische Wechselfelder. |
| EC-/Kreditkarten | Nutzen Magnetstreifen zur Datenspeicherung. |
| Elektromagnetische Schlösser | Verriegeln/Entriegeln Türen mithilfe eines Magneten. |
| Elektrische Zahnbürsten | Bewegung des Bürstenkopfs durch Magnetfelder. |
| Fernseher & Bildschirme | Nutzen Elektronenstrahlen, die durch Magnetfelder gelenkt werden. |
Transformator
Da elektrische Stromleitungen hunderttausende elektrische Volts transportieren, bevor die Elektrizität in Eurem Toaster landet, welcher kaum 200 Volts braucht), muss zuerst die Spannung verringert werden, Dafür gibt es Transformatoren.
Sie basieren auf zwei Drahtspulen. Die riesige elektrische Spannung läuft durch die erste Spule. Legt man eine Spule mit weniger Windungen daneben, so springt der elektrische Strom zur nächsten Spule und hat dann eine niedrigere Spannung.
Ohne dieses kleine Gerät könntet Ihr Eure Elektrogeräte im Haus nicht verwenden. Zu Transformatoren haben wir übrigens auch einen eigenen detaillierten Artikel verfasst!
Magnetschwebetechnik
Eine der coolsten auf Elektromagnetismus basierenden Erfindungen ist die Magnetschwebetechnik. Sie erlaubt es Zügen zu schweben und so dank weniger Reibung schneller und effizienter zu fahren.

Hierfür werden extrem starke Magneten benötigt. Ein Set Magneten hebt den Zug von den Schienen und die andere treibt ihn auf der Strecke an.
Mit KI zusammenfassen: