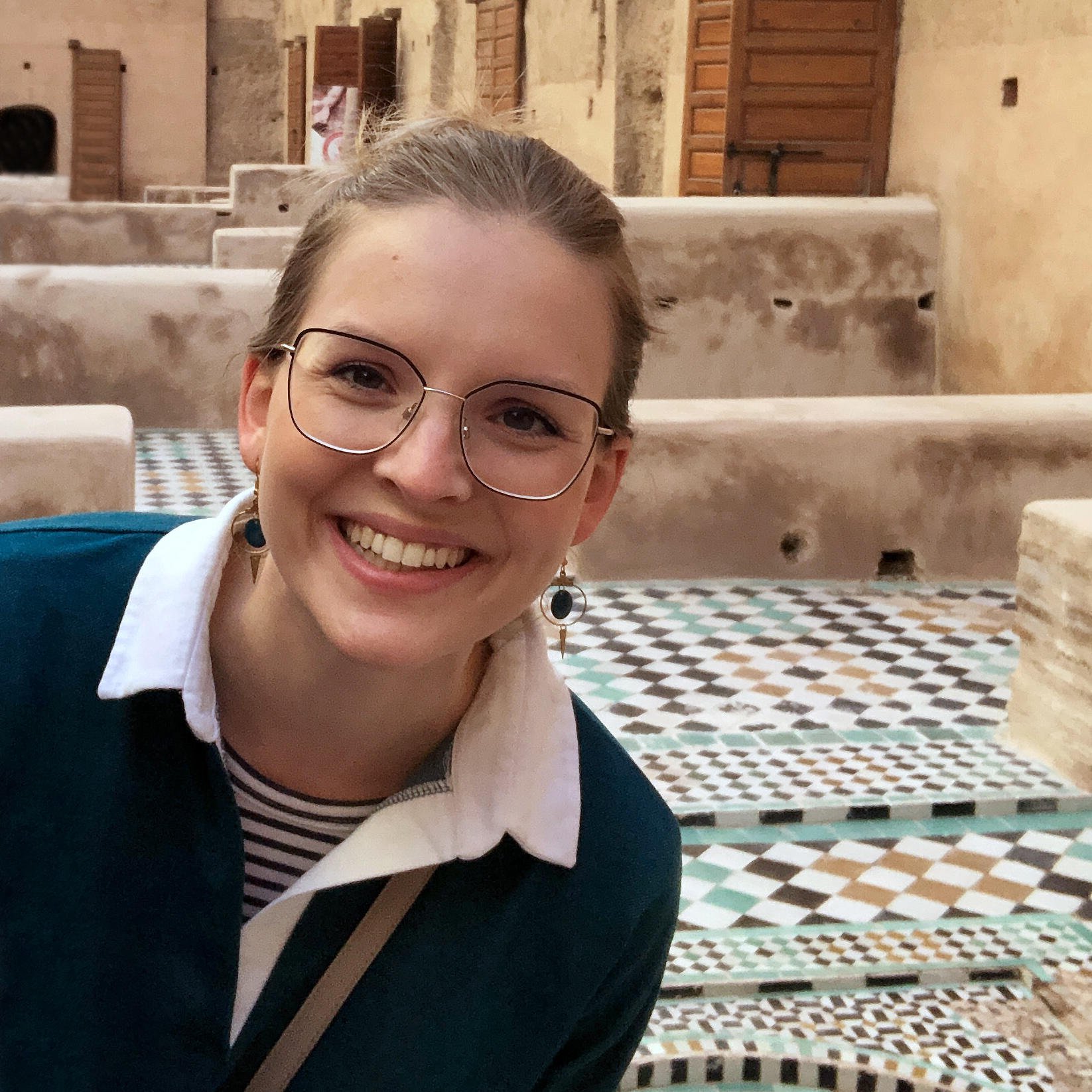Begegnungen mit dem Rechnungswesen können an unterschiedlichen Orten vorkommen: In der Schule, im Studium oder später im Beruf. Vor allem, wenn du BWL oder ein anderes Wirtschaftsstudium absolvierst oder dich für eine Ausbildung zum Bilanzbuchhalter interessierst, kommst du um das betriebliche Rechnungswesen inklusive Accounting, Bilanzierung, Finance und Controlling nicht herum.
Für nicht wenige Menschen wirken die Inhalte dieser Fächer zunächst eher trocken und schwer verständlich. Das schmälert aber nicht ihre Bedeutung: Das Rechnungswesen ist das Kernstück eines jeden Unternehmens, da es die erfolgsrelevanten Zahlen im Auge behält und die wirtschaftliche Lage erfasst.
Neben der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, zum Beispiel für die Festlegung der Steuern, ist das Rechnungswesen auch für das Unternehmen selbst elementar. Wie sonst soll es wissen, ob die eingeschlagene Strategie sich auszahlt und Erfolgsziele erreicht werden. Würden keine Buchhalter und Controller einen Blick auf die Rentabilität und Liquidität halten, würden so einige Unternehmen bald in der Zahlungsunfähigkeit landen.
Wenn du dich also erst einmal dafür entschieden hast, diesem wichtigen Teil der Organisationslehre deine Aufmerksamkeit zu schenken, wirst du schon bald feststellen, dass es so kompliziert auch gar nicht ist. Lerne zunächst, wichtige Grundbegriffe und Grundsätze zu verstehen und taste dich dann Schritt für Schritt an die verschiedenen Rechnungsarten heran.
Dieser Artikel gibt dir einen ersten Einblick in die Grundlagen des Rechnungswesens. Diese zu verinnerlichen, hilft dir auf deinem Karriereweg im Rechnungswesen und auch in anderen Bereichen ungemein!

Definition und Aufgaben des Rechnungswesens
Wie der Name bereits vermuten lässt, wird im Rechnungswesen eines Unternehmens fleißig gerechnet: Es befasst sich mit allen quantifizierbaren Vorgängen und betriebswirtschaftlichen Daten. Diese werden erfasst, ausgewertet und kontrolliert. Die vier Hauptaufgaben des Rechnungs- und Finanzwesens sind:
- Dokumentation anhand von Belegen
- Information für externe und interne Interessensgruppen
- Kontrolle der Wirtschaftlichkeit und Liquidität
- Planung strategischer Entscheidungen auf Basis quantitativer Erkenntnisse
Wir haben auch Nachhilfe Rechnungswesen Salzburg für dich!
Externes und internes Rechnungswesen
Dazu unterteilt sich das Rechnungswesen in das interne und externe Rechnungswesen. Das interne Rechnungswesen richtet sich an Geschäftsführer und andere Führungskräfte oder Entscheidungsträger. Es ist auch unter dem Namen Controlling bekannt und liefert die rechnerischen Grundlagen für Erkenntnisse und strategische Entscheidungen in Bezug auf die Erreichung wichtiger Unternehmensziele. In der Ausgestaltung des internen Rechnungswesens unterliegt das Unternehmen keinen bindenden gesetzlichen Anforderungen.
Im externen Rechnungswesen jedoch müssen die Vorschriften des Unternehmensgesetzbuches (UGB) sowie das Steuerrecht eingehalten werden. Schließlich sind die Adressaten hier der Staat, zum Beispiel im Sinne der Finanzämter, Gläubiger, Gesellschafter, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Kunden und Kundinnen sowie die allgemeine Öffentlichkeit. Das Unternehmen legt diesen Parteien auf Grundlage der Publizitätspflicht in regelmäßigen Abständen Rechenschaft ab, wie beispielsweise mit dem Jahresabschluss und/oder der Bilanz.
Neben dem externen und internen Rechnungswesen gibt es zwei weitere Bereiche des Rechnungswesens: Die betriebswirtschaftliche Statistik und Vergleichsrechnung sowie die Planungsrechnung bzw. Budgetierung. Alle vier Bereiche nutzen bestimmte Werkzeuge und Rechnungsformen.
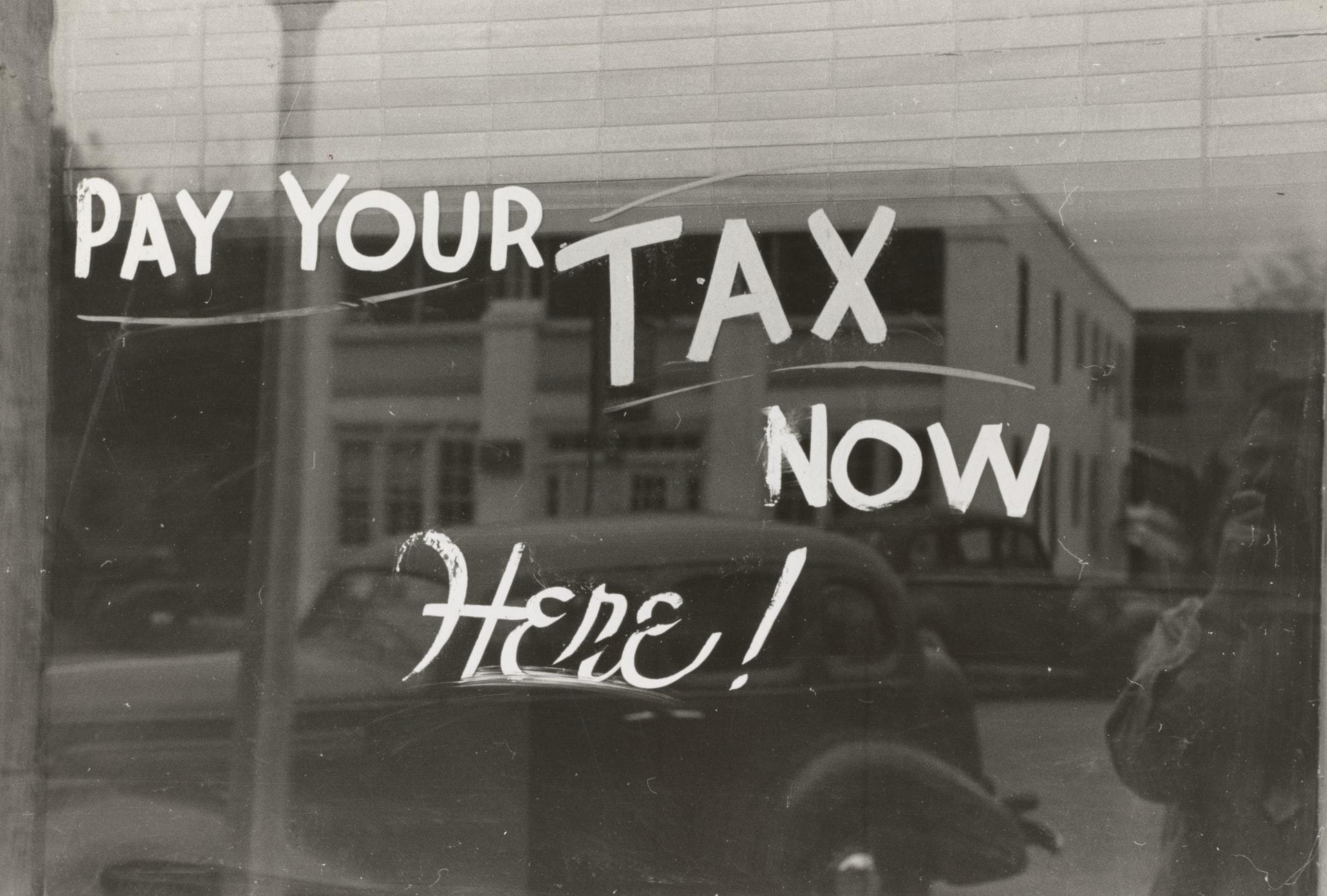
Auf der Suche nach Online Nachhilfe Rechnungswesen?
Grundbegriffe im Rechnungswesen
Das Rechnungswesen nutzt streng definierte Begriffe, die ohne die notwendigen Kenntnisse nicht eindeutig zu verstehen sind. Daher erläutern wir dir hier kurz die wichtigsten Grundbegriffe und Abkürzungen, damit deinem weitergehenden Verständnis der Buchführung, des Controlling, des Accounting und Finanzwesen nichts im Wege steht.
Umsatz
Der Umsatz ist die Summe aller Einnahmen eines Unternehmens - also das Geld und die Forderungen, die durch die Erbringung von Leistungen eingenommen wurden.
Gewinn
Der Gewinn ist der Umsatz minus Ausgaben. Das bedeutet, das entstandene Kosten für die Leistungserbringung von den Einnahmen abgezogen werden. Nur der tatsächliche Gewinn ist die Grundlage für Steuern an das Finanzamt.
Forderung
Erbringt ein Unternehmen eine Leistung gegenüber eines Kunden, entsteht eine Forderung - das Unternehmen darf eine Bezahlung vom Kunden fordern. Nicht immer geht eine Forderung direkt mit der Bezahlung einer Rechnung einher, so dass der Vorgang dann zunächst als "offene Forderung" in die Bilanz aufgenommen wird. Geschäftsvorgänge werden so bereits vor dem Zahlungsfluss ordnungsgemäß erfasst.

Wusstest du es?
Mit Superprof findest du ganz entspannt deine RW Nachhilfe.
Einzahlung und Auszahlung
Die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen gibt Auskunft über die Liquidität einer Organisation. Hier werden tatsächliche Zahlungsströme erfasst: Kommt Geld in Form liquider Mittel (zum Beispiel Bargeld) in die Kasse rein, handelt es sich um eine Einzahlung. Gehen liquide Mittel aus der Kasse raus, liegt eine Auszahlung vor.
Einnahme und Ausgabe
Einnahmen und Ausgaben verändern das Geldvermögen eines Unternehmens. Bei einer Einnahme wird das Vermögen größer, indem entweder liquide Mittel hereinkommen oder sich der Forderungsbestand erhöht. Bei einer Ausgabe verlassen entweder liquide Mittel das Unternehmen oder es werden Schulden aufgenommen. Hier müssen also nicht zwangsweise tatsächliche Zahlungsströme vorliegen.
Ertrag und Aufwand
Ertrag und Aufwand erhöhen bzw. schmälern den Unternehmensgewinn. Es werden nur Vorgänge betrachtet, die eine direkte Auswirkung auf den Gewinn haben. Das umfasst neben dem Geldvermögen auch das Sachvermögen, wie Maschinen, Grundstücke, Gebäude etc. Es handelt sich um zwei Basisgrößen des externen Rechnungswesen, die der Gewinnerfassung dienen.
Kosten und Leistungen
Kosten und Leistungen hingegen spielen im internen Rechnungswesen eine Rolle. Sie beziehen sich einzig auf betriebliche Aktivitäten und beeinflussen das betriebsnotwendige Vermögen.
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
In Österreich gibt es Grundsätze, nach welchen die Buchführung und Bilanzierung zu agieren haben. Diese sind in den §§ 190 ff UGB (Unternehmensgesetzbuch) geregelt. In Österreich müssen folgende Prinzipien eingehalten werden:
- Wahrheit
- Vollständigkeit
- Klarheit
- Stichtagsprinzip
- Imparitätsprinzip
- Realisationsprinzip
- Stetigkeit
- Einzelbewertung
- Vorsicht
Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)
Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) ist eine vereinfachte Form des Jahresabschlusses für Selbständige sowie kleine und mittlere Unternehmen, die nicht der Publizitäts- und Buchführungspflicht unterliegen. Es handelt sich um eine simple Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben zur Ermittlung des zu versteuernden Gewinns. Für alle anderen Unternehmen gelten die Grundsätze der Bilanzierung und der doppelten Buchführung, welche wir im folgenden Abschnitt erläutern.
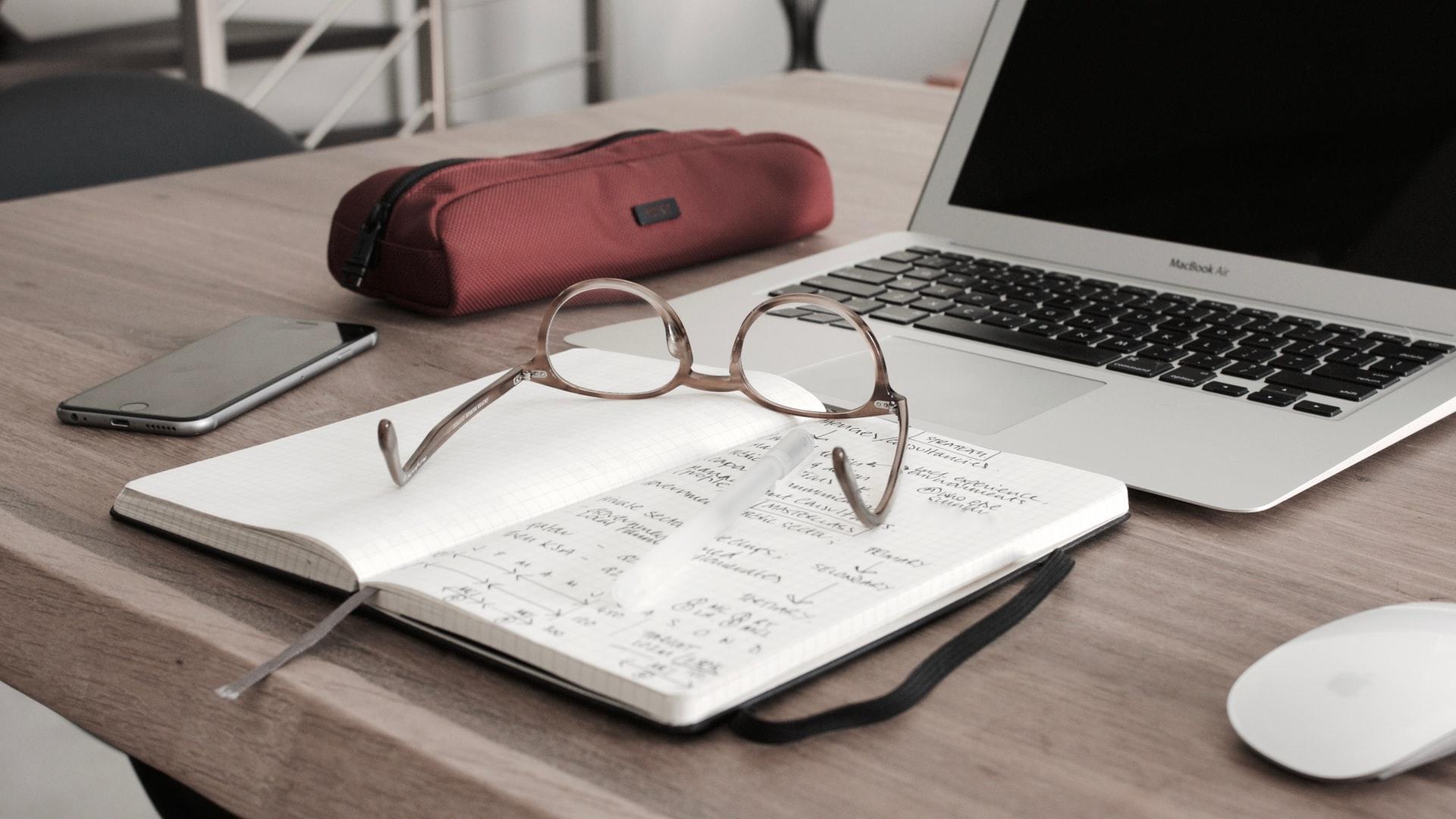
Die doppelte Buchführung einfach erklärt
Die Buchführung bildet einen wichtigen Teil des Rechnungswesen, insbesondere des externen Rechnungswesens. Hier werden alle Geschäftsvorfälle mit Belegen wie Rechnungen oder Quittungen erfasst. Elementar für alle Organisationen, die der Buchhaltungspflicht unterliegen, ist die doppelte Buchführung, auch Doppik (= doppelte Buchführung in Kontenform) genannt.
Die Verpflichtung zur doppelten Buchführung wird auch als Rechnungslegungspflicht oder Bilanzpflicht bezeichnet. Die Verpflichtung zur doppelten Buchführung ist in Österreich abhängig von der Rechtsform eines Unternehmens und der Höhe der Umsätze. Dabei wird grundsätzlich "Soll an Haben" gebucht.
Welche Konten für eine Buchung relevant sind, legt der Standard-Kontenrahmen fest. Es sind dabei aber auch individuelle Anpassungen je nach Organisation möglich. Eine Lehrkraft für Nachhilfe Rechnungswesen, kann dir das alles im Handumdrehen erklären! Superprof bietet dir eine vielfältige Möglichkeit von Rechnungswesen Nachhilfe Wien bis Salzburg.
Bestandskonten vs. Erfolgskonten
Unterschieden wird zwischen Bestandskonten und Erfolgskonten. Bestandskonten unterteilen sich in Aktiva (Vermögen) und Passiva (Kapital) und stehen in direktem Bezug zur Bilanz - besser gesagt, setzt sich die Bilanz aus den Kontosummen der Bestandskonten zusammen. Nimmt das Aktivkonto zu, wird dies im Soll und die Abnahme im Haben gebucht. Bei einem Passivkonto wird die Zunahme hingegen im Haben und die Abnahme im Soll erfasst. Diese Regeln sorgen dafür, dass in der Bilanz letztendlich auf der Aktiva- und Passiva-Seite die selbe Summe herauskommt - auch bekannt als Bilanzsumme.
Erfolgskonten sind Unterkonten des Passiva-Konto Eigenkapital. Sie bilden die Grundlage für die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und unterteilen sich in Ertragskonten und Aufwandskonten. Das Ergebnis der GuV wird in der Bilanz im Posten Eigenkapital auf der Passivseite festgehalten: Ein Gewinn löst eine Addition aus, ein Verlust eine Subtraktion. Die Buchungsregeln für Erfolgskonten besagen, dass eine Zunahme des Aufwandskonto im Soll und eine Abnahme im Haben gebucht wird. Andersherum wird eine Zunahme der Ertragskonto im Haben und eine Abnahme im Soll erfasst.
Beispiele für Buchungssätze
Ein Unternehmen kauft Büromaterialien im Wert von 100 Euro und bezahlt diese per Banküberweisung.
Dieser Vorgang betrifft das Bankkonto, ein aktives Bestandskonto, sowie das passive Bestandskonto "Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe". Auf dem Aktivkonto erfolgt eine Abnahme und damit eine Buchung im Haben, während auf dem Passivkonto durch die Zunahme eine Buchung des Rechnungsbetrags im Soll gebucht wird.
Entsprechend des Buchungsgrundsatzes "Soll an Haben" lautet der Buchungssatz hier:
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe an Bank 100
Was du über die Kosten- und Leistungsrechnung wissen solltest
Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist Teil des internen Rechnungswesens und befasst sich mit der innerbetrieblichen Leistungserstellung. Die Basisgrößen sind die oben bereits definierten Kosten und Leistungen. Die Differenz zwischen Kosten und Leistungen ergibt das Betriebsergebnis, welches sowohl positiv als auch negativ ausfallen kann.
Anders als die Finanzbuchhaltung unterliegt die KLR keinen strengen gesetzlichen Regelungen und erfasst nur solche Aufwände und Erträge, die im Zusammenhang mit dem betrieblichen Leistungsprozess stehen. Es werden also nur die Kosten bewertet, die für die Leistungserbringung (Produktion) relevant sind.
Ein wichtiger Zweck der KLR ist es, Kosten und Erträge spezifischen Verursachern zuzuordnen. Wichtige Begriffe sind dazu die folgenden:
- Kostenarten nach Kategorien, zum Beispiel Materialkosten oder Personalkosten
- Kostenstellen = Orte, an denen Kosten entstehen, wie Abteilungen oder Unternehmensbereiche
- Kostenträger im Sinne der Produkte oder Dienstleistungen, deren Herstellung Kosten verursacht
Die KLR umfasst also eine Kostenartenrechnung, eine Kostenstellenrechnung und eine Kostenträgerrechnung.
Die Erfassung von Betriebsgewinn und Betriebsverlust aufgeschlüsselt nach Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgern ermöglicht eine kurzfristige Entscheidungsfindung. Entscheidungsträger erhalten Einblicke, wo welche Kosten entstehen und wodurch. So wird die Wirtschaftlichkeit einzelner Abteilungen und Produkte festgestellt.
Da nicht alle Kostenarten haargenau auf spezifische Kostenstellen oder Kostenträger zuordnungsfähig sind, wird in solchen Fällen mit Verteilungsschlüsseln gearbeitet. Das umfasst Gemeinkosten wie zum Beispiel für Miete. Das Gegenteil von Gemeinkosten sind Einzelkosten, welche direkt zuordnungsfähig sind.
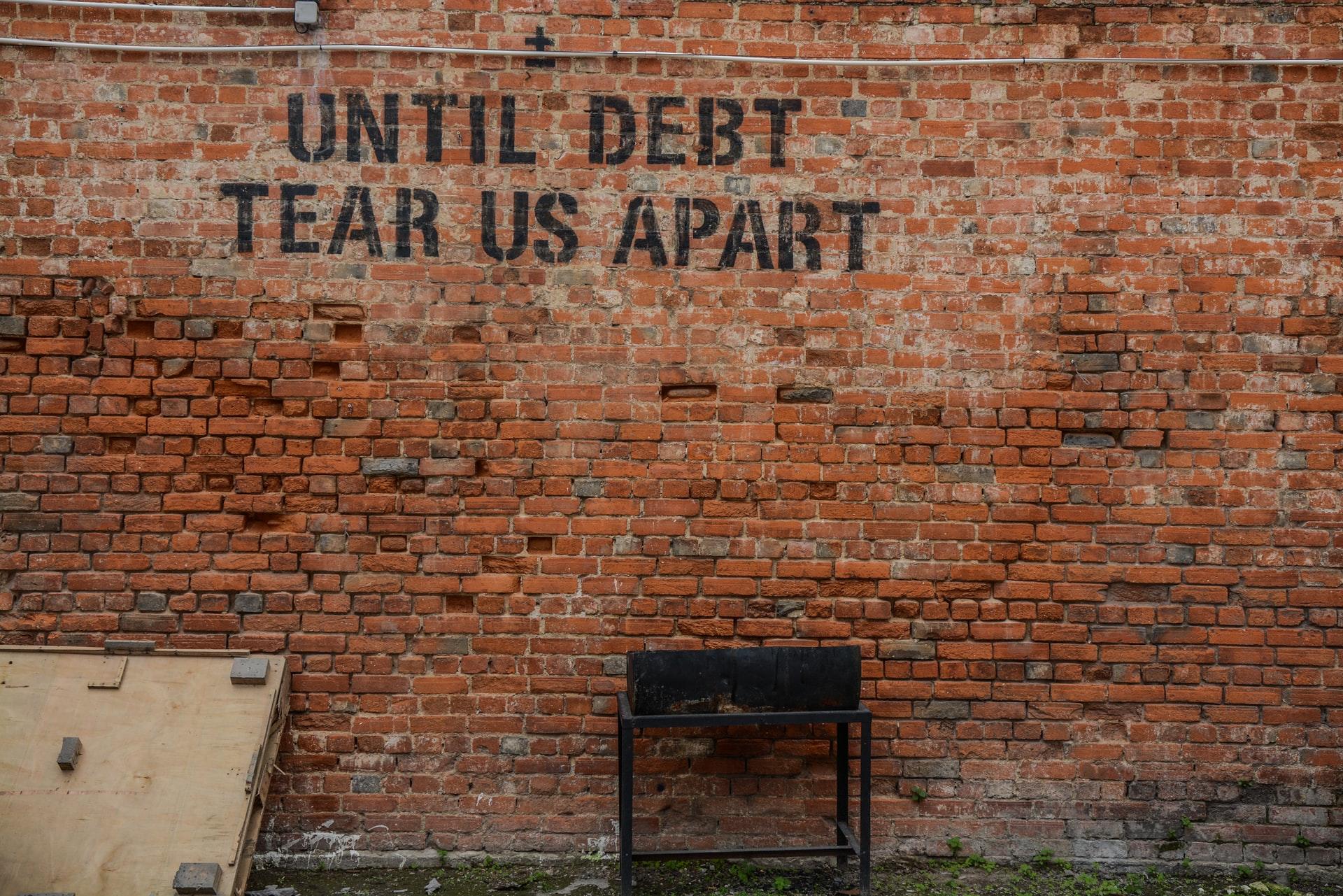
Die KLR lässt sich weiterhin in die Vollkostenrechnung sowie die Teilkostenrechnung unterteilen. Zur Vollkostenrechnung zählen:
- Plankostenrechnung
- Normalkostenrechnung
- Istkostenrechnung
Die Teilkostenrechnung hingegen unterteilt sich in die Bereiche
- Deckungsbeitragsrechnung
- Grenzplankostenrechnung
- Zielkostenrechung
Zusammengefasst dient die Kosten- Leistungsrechnung der Kalkulierung, Kontrolle und Planung durch den regelmäßigen Vergleich von Kosten und Leistungen innerhalb einer Organisation.
Mit KI zusammenfassen: